|
|
|
|
|
|
|
Zweimassenschwungrad, ZMS
Die Fahrzeugentwicklung der letzten Jahrzehnte
hat sich auch besonders dem Fahrkomfort verschrieben. So ist
das Ziel, dem Fahrer sowie der gesamten Fahrzeugbesatzung
ein möglichst bequemes und angenehmes Fahrgefühl
zu vermitteln. Schaltvorgänge mit „rupfender“
Kupplung oder generell Vibrationen, etwa im Leerlauf, wiedersprechen
diesem Ideal.
Beim Zweimassenschwung (ZMS) ist die eine Masse (Primärmasse)
fest mit der Kurbelwelle verschraubt und trägt den Zahnkranz
analog wie beim klassischen, starren Schwungrad.
An der Sekundärmasse ist die Druckplatte verschraubt
und zwischen den Reibbelägen die (jetzt starre) Mitnehmerscheibe
angeordnet. Die technische Besonderheit beruht nun auf der
Verbindung zwischen Primärmasse und Sekundärmasse.
Hier sorgt ein fettgefülltes Feder-Dämpfersystem,
mit speziellen Kennlinien, für die Entkopplung von Drehschwingungen
seitens Motor und Getriebe.
|

Im Bild: 2-Massenschwungrad BMW M3 Coupe (E90, E92)
|
Schwingungsdämpfung
bisher:
Ähnliche Maßnahmen gibt es allerdings
auch bereits bei herkömmlichen Kupplungen, wenngleich
in einfacher Ausführung. So sorgt die Torsionsfederung
in der Mitnehmerscheibe ebenfalls für eine entsprechende
Dämpfung. Bei jedem Ein- und Auskuppelvorgang wird der
Innenring (Getriebeeingangswelle) der Mitnehmerscheibe leicht
gegen den Außenring (Reibfläche) gedreht –
abgefedert durch mehrere radial angeordnete Druckfedern.
|
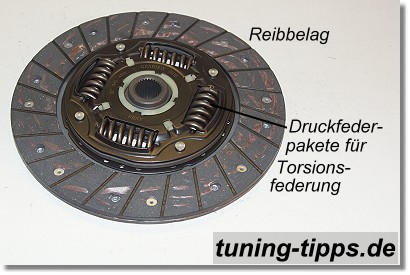
Die Torsionsdämpfung bei herkömmlichen Mitnehmerscheibe
|
| Aus Sicht des Tunings sollten zwei Nachteile
des Zweimassenschwungs nicht unerwähnt bleiben:
Der Gewichtsaspekt - Der Zweimassenschwung hat ein deutliches
Gewichtsplus gegenüber starren Schwungscheiben.
Die Ausfallwahrscheinlichkeit – starke Leistungszuwächse
bringen die Verbindungsstellen von Primär- und Sekundärscheibe
schnell an ihre Grenzen, da der ZMS halt für eine bestimmte
Leistung ausgelegt ist und eben nicht für extreme Leistungssteigerungen
konzipiert wurde.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

